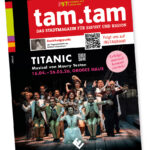Mit dem anhaltenden Lockdown ist der Zugang zu kulturellen Angeboten außerhalb der eigenen vier Wände weiterhin empfindlich eingeschränkt – ein Umstand, der das Buch noch mehr als sonst zu einer willkommenen Alternative werden lässt. Bei der Qual der Wahl der passenden Lektüre stehen wir natürlich gern hilfreich zur Seite — mit Büchertipps zu aktuellen Neuerscheinungen. Heute:
H.D. Walden: »Ein Stadtmensch im Wald«
Bericht eines Naturbanausen

Galiani Berlin, 110 Seiten (geb.)
Als sich im vergangenen Frühjahr die uns mittlerweile allseits vertraute Virus-Seuche anschickte, auch Mitteleuropa mit ihrem Bann zu belegen, beschloss der namenlose Ich-Erzähler in H.D. Waldens Bericht „Ein Stadtmensch im Wald“, den plötzlich eingetretenen Unwägbarkeiten des urbanen Lebens den Rücken zu kehren und in der Waldhütte seiner Freundin Zuflucht zu suchen. Tief im Ruppiner Wald- und Seengebiet, das, wie eben jene Freundin behauptet, so verlassen ist, dass die Waldtiere nicht einmal wüssten, was Menschen sind und diese ganz arglos und ohne Scheu für besonders eigenwillig auftretende Kühe hielten. Eine Gegend also wie geschaffen für ein paar Tage des sorglosen Durchatmens in krisengeschüttelten Zeiten.
Einziges ‘Problem‘: Er, der Ich-erzählende Schriftsteller, weiß als Bildungsbürger zwar durchaus, was ein Wald ist – hat als ausschließlich als gut sozialisierter Stadtmensch jedoch gerade einmal so viel Wissen und Kenntnisse über die dort auffindbare, also ansässige Natur vorzuweisen wie sie eben ein reiner Stadtmensch typischerweise so hat: keine, nada, niente. Der Baum ist ihm ein Baum, der Vogel ein Vogel – bis jetzt.
Denn nun, mangels mitgebrachter Aufgaben und weitestgehend offener Aufenthaltsdauer findet er jede Menge Gelegenheit, sich mit den Bewohnern des Waldes vertraut zu machen, vor allem jenen, die ihn in seiner stillen Hütte besuchen. Da wären schon einmal all die gefiederten Tiere, die da angeschwirrt kommen und ihn ob ihres so unterschiedlichen Auftretens an der Futterstelle vor der Hütte – und unter Zuhilfenahme einer Handy-Vogelbestimmungs-App – im Handstreich zu einem fasziniert-begeisterten Tierbeobachter werden lassen. Gerade auch, weil die gefiederten Freunde so unterschiedliche Charaktere zum Vorschein bringen: die Mönchsgrasmücke benimmt sich draufgängerisch wie Tom Cruise in „Mission Impossible“, das bauchige Dompfaffen-Pärchen tröge-behäbig wie zwei lebenssatte Datschenkolonisten und die Kleiber derart überdreht als würden sie Kokain schnupfen statt Körner zu schlucken.
Ein komplett anderes, aber nicht weniger faszinierendes Auftreten legen in seiner Wahrnehmung jene Bewohner des Waldes an den Tag bzw. die Nacht, die nach Einbruch der Dunkelheit beschäftigen. Da rumpelt die Maus im Dachgebälk als müsste sie allabendlich die Möbel umstellen, schaut der Waschbär mit täglicher Gewohnheit vorbei, um der ‘seltsamen, zweibeinigen Kuh‘ aus der Waldhütte zu zeigen, wer von beiden der Clevere ist, da präsentiert sich ein fußballgroßer Igel mit stoischem Gleichmut an seiner Tür, um Abend für Abend seinen Anteil an der Fütterungsorgie einzufordern, die der Besucher aus der Stadt alsbald einleitet, um all die Einheimischen zufriedenzustellen, die da über Tage und Wochen hinweg immer regelmäßiger vorbeischauen – und ihm in seinem schnell nur noch aufs Füttern, Beobachten und Erstellen von tierischen Psychogrammen beschränkten Walddasein alsbald gar nicht mehr wie fremde, wilde, sondern immer vertrautere Wesen erscheinen. Vor allem bei Schupp, dem Waschbär, kann er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich da in puncto Kommunikation tatsächlich etwas überträgt, eine Art Verstehen in dessen Augen aufblitzt, wenn er mit ihm spricht. Gar zu gern, wirklich gar zu gern würde er ihn einmal – einmal nur – kraulen und streicheln wollen, doch so schnell will sich der pelzige Waldbewohner vom Stadtmenschen dann doch nicht auf den Arm nehmen lassen…
Eine Seuche als Rahmen, einen großen Wald mit entlegener Hütte als Setting, einen eingefleischten Stadtmenschen nebst zahllosen gefiederten, bepelzten oder bestachelten Tiere als Hauptdarsteller und eine mal (selbst)ironisch-amüsante, mal nachdenklich-beobachtende Erzählweise, die nie auch nur ansatzweise den Eindruck von Langweile vermittelt – mehr braucht es nicht für die Entstehung dieses besonderen, sehr vergnüglichen, leise-weisen Natur-Erfahrungsberichts H.D. Waldens (a.k.a. Linus Reichlin), der sich da in kaum verkennbarer Referenz zu Henry David Thoreaus „Walden“ inmitten seiner Waldeinsamkeit selbst bestaunt. Perfekt komponierte literarische Wohltat für den zweiten Pandemie-Frühling.